Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, leiden häufig unter Dekubitus. Auch als Rollstuhlfahrer kann für Dich ein erhöhtes Risiko bestehen.
Wie Du dem entgehen kannst, was die Definition von Dekubitus ist und worum es sich bei der Erkrankung genau handelt, erfährst Du in diesem Blogbeitrag.
Definition: Was ist Dekubitus?
Im alltäglichen Sprachgebrauch spricht man auch von Druckgeschwüren oder Wundliegegeschwüren. Diese entstehen, wenn eine Hautpartie einem lang anhaltenden Druck von außen ausgesetzt ist. Durch diesen werden Blutgefäße abgeklemmt und damit auch die Versorgung mit Nährstoffen und Sauerstoff behindert.
Wie entsteht ein Dekubitus? Dekubitus einfach erklärt: Die gestörte Durchblutung führt zunächst zu einer Schädigung der betroffenen Hautoberfläche. Je nach Verlauf kann es außerdem zur Nekrose (Absterben des Gewebes) und zu tiefen, offenen Wunden kommen. Gerade bei Letzteren besteht ein erhöhtes Risiko einer Infektion. Besonders häufig sind Körperteile betroffen, an denen nur eine dünne Hautschicht direkt über dem Knochen liegt – so zum Beispiel Steißbein, Fersen oder Hüfte.
Die Entstehung eines Dekubitus kann durch einen Pflegefehler angestoßen werden. Deshalb wird die Erkrankung häufig als Anhaltspunkt für die Pflegequalität gewertet.
Klassifizierung von Druckgeschwüren
Abhängig vom Schweregrad des Dekubitus wird dieser in unterschiedliche Kategorien eingeteilt.
Dekubitus Grad 1: Klar abgrenzbare Rötung, die geschwollen, verhärtet, wärmer oder kälter sein kann. Sie ist auch ohne akuten Druck sichtbar.
Dekubitus Grad 2: Die Stelle weist kleinere Schäden auf. Das können Blasen oder auch Abschürfungen sein.
Dekubitus Grad 3: Offene Stellen und abgestorbenes Gewebe. Die Schädigung geht über die oberste Hautschicht hinaus bis in tiefere Strukturen.
Dekubitus Grad 4: Das Gewebe ist so stark und tief beschädigt, dass Sehnen, Muskeln oder sogar Knochen freiliegen.
Faktoren, die Dekubitus begünstigen
In der Regel verändern Menschen ihre Sitz- oder Liegeposition regelmäßig – spätestens, wenn sie einen unangenehmen Druck verspüren. Wer allerdings nicht mobil ist, kann häufig nicht selbst für diesen Positionswechsel sorgen.
Zusätzliche Faktoren können das Dekubitus-Risiko weiter erhöhen. Dazu gehören beispielsweise:
- Vermindertes Schmerzempfinden und wenig Gefühl an betroffenen Stellen können Ursachen sein.
- Unterernährung: Diese führt dazu, dass der Puffer zwischen Haut und Knochen noch geringer ist. Zudem leidet in der Regel die Haut der Patienten und ist ohnehin schon angegriffen.
- Übergewicht (Adipositas), da der Druck beim Liegen/Sitzen so noch höher ist.
- Hautschäden durch Nässe (beispielsweise durch Inkontinenz oder Schweiß), aber auch besonders trockene Haut.
- Dehydration (Flüssigkeitsmangel)
- Krankheiten, die eine Mangeldurchblutung bedingen.
- Reibung über empfindliche Hautpartien.
- Scherkräfte, wie sie beispielsweise entstehen, wenn Körperstellen über einen Untergrund gezogen werden.
Bin ich als Rollstuhlfahrer gefährdet?
Viele der oben genannten Faktoren können auch auf Rollstuhlfahrer zutreffen. Das lange Sitzen, womöglich auf einem unbequemen Sitz oder durch eine falsche Position, kann das Risiko weiter erhöhen. Falsche Rollstuhlmaße können Dekubitus ebenfalls begünstigen.
Als Rollstuhlfahrer solltest Du (falls möglich) regelmäßige Positionswechsel zur Druckentlastung vornehmen. Zudem ist die Wahl des passenden Rollstuhl-Modells relevant: Achte am besten darauf, dauerhaft bequem zu sitzen und etwas Platz zwischen Körper und Rahmen zu haben. Weitere Hinweise findest Du übrigens in unserem Blogbeitrag Rollstuhlmaße: Weshalb Du die Anpassung Deines Rollstuhls nicht unterschätzen solltest.
Grundsätzlich empfiehlt es sich allerdings, sich von Fachpersonal beraten zu lassen.
Zu den häufig von Dekubitus betroffenen Körperteilen bei Rollstuhlfahrern zählen:
- Hinterkopf (sofern hohe Lehne vorhanden)
- Schulterblatt
- Hüfte
- Steißbein
- Sitzbein
- Fersen
Früherkennung von Dekubitus
Bist Du stark in Deiner Mobilität eingeschränkt, solltest Du Dein Dekubitus-Risiko nicht unterschätzen. Wichtig ist, dass Du Deinen Körper regelmäßig im Hinblick auf rote Flecken untersuchst bzw. untersuchen lässt.
Erste Anzeichen lassen sich mithilfe des Fingertests ermitteln:
Entdeckst Du eine rote Stelle an Deinem Körper, übe mit einem Finger Druck auf diese aus. Beobachte genau, was passiert: Wenn der Fleck unverändert bleibt und sich kein weißer Punkt bildet, handelt es sich ziemlich sicher um eine Druckstelle (Kategorie 1).
In diesem Fall solltest Du Rücksprache mit Deinem Arzt halten, um ein weiteres Vorgehen zu besprechen. Je früher die Stelle behandelt wird, desto eher kannst Du eine Verschlimmerung umgehen.
Behandlungsmaßnahmen von Dekubitus
Ist es doch zur Entstehung eines Dekubitus gekommen, muss dieser zwingend behandelt werden. Wichtig: Zur fachgerechten Einschätzung solltest Du immer medizinisches Personal zurate ziehen.
Die Art der Therapie hängt stark mit dem Schweregrad der Wunde zusammen. Grundsätzlich muss eine Druckentlastung der entsprechenden Stelle stattfinden. Durch diverse Wundauflagen werden offene Wunden behandelt. Zusätzlich wird auf Schmerzmittel zurückgegriffen. Neben der körperlichen Versorgung ist oft auch eine persönliche Betreuung von Nöten. Dekubitus kann bei den Patienten unter anderem Schamgefühle auslösen, unter denen die Psyche der Betroffenen leidet.
Vorbeugende Maßnahmen bei Druckgeschwüren
Das Abheilen einer solchen Wundstelle ist langwierig und schmerzhaft. Aus diesem Grund sollte alles Mögliche darangesetzt werden, sie gar nicht erst entstehen zu lassen.
Die wichtigste vorbeugende Maßnahme besteht darin, die Liege- oder Sitzposition regelmäßig zu verändern. So kann der Druck auf eine bestimmte Körperstelle entlastet werden und das Risiko eines Dekubitus sinkt. Ist das aus eigener Kraft nicht möglich, sollte die Hilfe einer anderen Person zurate gezogen werden.
Außerdem solltest Du stets darauf achten, Deine Haut gut zu pflegen und instand zu halten. Das bedeutet:
- ausreichend trinken
- ausgewogene Ernährung/Nährstoffzunahme
- bei Bedarf entsprechende Hautpflege und Cremes nutzen
Allgemein gilt: Achte auf die Zeichen Deines Körpers. Sofern Du spürst, dass eine Körperstelle wund ist oder die Haut anders in Mitleidenschaft gezogen wird, behalte sie im Auge.
Zusätzlich können spezielle Dekubitus-Kissen oder Matratzen das Risiko des Wundliegens verringern. Außerdem gibt es verschiedene Maßnahmen zur Dekubitusprophylaxe, die Du ergreifen kannst, um Druckstellen vorzubeugen.
ergoflix und Dekubitus
Wir nehmen das Thema Dekubitus sehr ernst. Daher findest Du in unserem Produktportfolio ein flaches sowie ein keilförmiges Anti-Dekubitus-Kissen für unsere ergoflix-Modelle. Beide Kissen verfügen über Luftzellen, welche mit Hilfe einer Handluftpumpe individuell reguliert werden können. Auf diese Weise wird Deine Sitzposition verbessert und der Entstehung von Dekubitus wird entgegengewirkt. Besonders praktisch: Der Bezug ist rutschfest und waschbar.
Sehr gerne berät unser Fachpersonal Dich vor dem Kauf Deines elektrischen Rollstuhls ausführlich. Gemeinsam finden wir heraus, welche Maße die richtigen für Dich sind, damit kein unnötiger Druck ausgeübt wird. Sprich uns einfach an. Du erreichst uns telefonisch unter der Nummer 02852 - 9459000 oder per E-Mail an info@ergoflix.de.






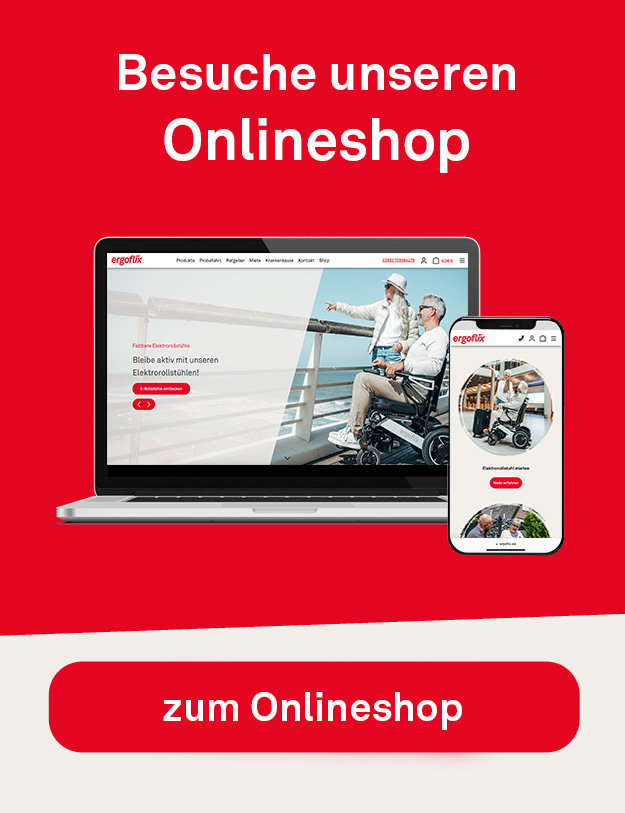

Zur Zeit wird mein Ehemann von einem Pflegedienst der nur für Dekubitus Behandlung eingesetzt wird ,versorgt. Man hat mir gesagt , das diese Behandlung von der Krankenkasse bezahlt wird. Heute sollte ich einen elf Seiten Din a vier Vertrag unterschreiben , der viele § enthält ,und so für mich unverständlich ist. Wie hoch sind die Kosten ,der Zuzahlung für den Betroffenen Kranken?
Hey,
vielen Dank für Deinen Kommentar. Leider können wir Dir nicht genau sagen, wie hoch die Zuzahlung bei der Dekubitus-Behandlung ist – denn dies ist ganz individuell. Unsere Empfehlung: Sprich mit Deiner Krankenkasse oder dem Pflegedienst und lasse Dir ganz genau erklären, was hinter den Paragrafen des Vertrags steckt. Frage auch, wie hoch die Kosten sind, die auf Euch zukommen.
Herzliche Grüße aus Hamminkeln
Dein ergoflix-Team